Migration aufgrund des Klimawandels
... mehr

Mehr Überschwemmungen, heftigere Unwetter und tödlichere Dürren: Der Klimawandel wirkt sich bereits auf Millionen Menschen aus und zerstört ihre Lebensgrundlagen. Doch die Gefahr, Opfer des Klimawandels zu werden, ist extrem ungleich verteilt.
Der Klimawandel ist in vollem Gang und erreicht traurige Rekorde. Die Jahre 2024, 2023 und 2020 waren die wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen. Schon jetzt hat sich die Temperatur im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um rund 1,5 Grad erhöht. Die Auswirkungen der globalen Erwärmung sind zum einen schleichende Veränderungen wie schmelzende Gletscher, der Anstieg des Meeresspiegels und die langsame Verschiebung von Klimazonen. Zum anderen verursacht die Erderwärmung Wetterextreme: mehr und heftigere Überschwemmungen, Hitzewellen, Stürme und Dürren.
“
„Der Klimawandel untergräbt die Anstrengungen beim Kampf gegen Armut und Hunger.“
Sabine Minninger
Klima-Expertin bei Brot für die Welt
Aufgrund von Wetterextremen verloren zwischen 1992 und 2012 fast 600.000 Menschen ihr Leben laut dem Büro der Vereinten Nationen für Katastrophenprävention. Forscherinnen und Forscher machen für ein Drittel der Hitzetoten zwischen 1991 bis 2018 den Klimawandel verantwortlich. Die wirtschaftlichen Schäden durch Wetterextreme haben sich dem Versicherungsunternehmen Munich Re zufolge seit 1980 verdreifacht. Aber die Gefahr, Opfer solcher Extreme zu werden, ist auf der Erde ungleich verteilt.
Entwicklungsländer sind von klimabedingten Schäden besonders betroffen, obwohl sie am wenigsten zum Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre beigetragen haben. Einerseits liegt das an ihrer geographischen Lage, andererseits sind die Menschen aufgrund ihrer Armut besonders verwundbar. So führen Wetterextreme in Staaten mit niedrigem Einkommen zu mehr Opfern, den verhältnismäßig größten wirtschaftlichen Schäden und zu einer großen Zahl Vertriebener. Die Nansen-Initiative beziffert die Zahl der Vertriebenen aufgrund klimawandelbedingter Naturkatastrophen für die Jahre 2008 bis 2013 auf 140 Millionen, wozu auch Binnenflüchtlinge und temporäre Flüchtlinge zählen. Bis zum Jahr 2050 prognostiziert die Weltbank bis zu 200 Millionen Menschen, die aufgrund des Klimawandels aus ihrer Heimat vertrieben werden.
Im Pariser Klimaabkommen vom Dezember 2015 erkennt die Weltgemeinschaft ihre gemeinsame Verantwortung an, sowohl die Klimarisiken zu mindern als auch den armen Staaten finanziell zu helfen. Sie sollen wirtschaftlich von der Umstellung auf erneuerbare Energien und ressourcenschonendes Wirtschaften profitieren. So stoppen sie den eigenen Ausstoß von Treibhausgasen und fördern nachhaltig ihre wirtschaftliche Entwicklung.
Außerdem soll ihre Klima-Resilienz – also die Widerstandsfähigkeit gegen die Folgen des Klimawandels – gestärkt werden. Damit reicht Paris weit über ein Klimaschutz-Abkommen hinaus und strebt eine sozial-ökologische Transformation an. Vor allem bietet es eine völkerrechtlich bindende Grundlage, Regierungen in die Verantwortung zu nehmen, ihren Versprechen auch nachzukommen. Deshalb ist es ein wichtiger Hebel für unsere klimapolitische Arbeit.
Zentrales Anliegen unserer klimapolitischen Arbeit ist es, den Klimawandel und seine Folgen für Mensch und Natur einzudämmen. Daher setzen wir uns gemeinsam mit unseren Netzwerken, ökumenischen Bündnissen und Partnerorganisationen für eine ambitionierte Ausgestaltung und Umsetzung des Pariser Vertrages ein, auf nationaler und internationaler Ebene. Ganz konkret unterstützen wir in unseren Projekten besonders verletzliche Bevölkerungsgruppen, sich an den Klimawandel anzupassen und widerstandsfähiger gegenüber Wetterextremen zu werden. So lernen Kleinbauern beispielsweise verbesserte Anbaumethoden und traditionelle, robuste Gemüsesorten zu nutzen.
Damit das Pariser Klimaabkommen von den Regierungen ambitioniert umgesetzt wird, brauchen wir eine informierte und aktive Öffentlichkeit, also Sie. Sie sollten von den politischen Entscheidungsträgern eine konsequente Umsetzung des Abkommens einfordern, damit es seine Wirkung entfalten kann. Im Vorfeld der Pariser Klimakonferenz hat der ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit ein gutes Beispiel für eine ökumenische Mobilisierung gesetzt. Darüber hinaus können Sie mit gutem Beispiel vorangehen und Treibhausgase vermeiden oder minimieren, indem Sie möglichst auf Inlandsflüge verzichten und bei kurzen Wegen das Fahrrad dem Auto vorziehen. Ergänzend können Sie Projekte zur Anpassung an den Klimawandel und zur Ernährungssicherung in den betroffenen Ländern unterstützen. Mit Hilfe Ihrer Spende können wir Projekte fördern, die den Klimawandel mildern oder ihm entgegenwirken.
FAQ – Fragen und Antworten zum Klimawandel
Der derzeitige Klimawandel bezeichnet die menschengemachte Erwärmung der Erde. Die Menschheit verbrennt seit Beginn der Industrialisierung Kohle, Erdöl und Erdgas in immer größerer Menge. Das darin vor Millionen Jahren gespeicherte CO2 entweicht in die Atmosphäre und verstärkt mit dem natürlich vorhandenen CO2 den Treibhaus-Effekt. Dadurch erwärmt sich die Erde in extrem kurzer Zeit. Neben CO2 gibt es noch weitere Treibhausgase wie Methan, dass bei der Förderung von Erdgas und Erdöl entweicht, aber auch in großen Mengen bei der Massentierhaltung entsteht.
Das Aufheizen der Atmosphäre und Ozeane hat zahlreiche verheerende Folgen. Die zusätzliche Wärme-Energie führt zu häufigeren und heftigeren Unwettern, was man schon heute spürt. Das Klima gerät aus dem bisherigen Gleichgewicht, die Niederschlagsmuster verändern sich und die Temperaturen. Es kommt zu Dürren, Starkregen, Überschwemmungen und Hitzeperioden. Das bedroht nicht nur die Lebensgrundlage der Menschen, sondern der gesamten Tier- und Pflanzenwelt. Da die Veränderungen extrem schnell kommen, sterben viele Lebewesen und ganze Tierarten.
Die Erwärmung führt auch zu schleichenden Veränderungen, mit irreversiblen Folgen. Die Polkappen schmelzen, der Meeresspiegel steigt, Permafrostböden tauen auf, ehemals fruchtbare Regionen verwüsten, sodass Menschen sie nicht mehr bewohnen können.
Die größte Gefahr durch den Klimawandel dürfte sein, dass er das gesamte Ökosystem Erde verändert, sodass ein sicheres menschliches Leben immer gefährdeter wird. Als Folge des fortschreitenden Klimawandels muss mit der Gefährdung der Ernährungssicherheit gerechnet werden, sowie mit Flucht und Vertreibung durch die Auswirkungen des Klimawandels und kriegerische Auseinandersetzungen um knapper werdende Ressourcen und Lebensgrundlagen. Noch sind die daraus resultierenden Hungerkrisen regional begrenzt, aber das kann sich bald ändern.
Grundlegend ist: Die Menschheit darf keine fossilen Energie-Träger mehr verbrennen. Sie darf keine Treibhausgase mehr in der Atmosphäre ausstoßen. Auch wenn der Klimawandel bereits voll im Gange ist, gibt es noch viele Handlungsoptionen, um die schlimmsten Auswirkungen abzufedern. Wichtig wäre die Umstellung von fossilen Energieträgern auf Erneuerbare Energien und das Einläuten einer klimaschützenden Verkehrs- und Agrarwende.
Neben ambitioniertem Klimaschutz ist es auch wichtig, sich an den Klimawandel anzupassen. Nur so kann man seine negativen Folgen abmildern. Zu den Anpassungsmaßnahmen zählen: Flächen entsiegeln, keine neuen mehr versiegeln, Regenwasser versickern, Hochwasserschutz, Städte und Behausungen verschatten, Schutzräume gegen Stürme schaffen, Nahrungsmittelproduktion umstellen weg von der Massentierhaltung, Landwirtschaft resistenter machen durch angepasste Sorten und Techniken, Nahrungsmittelverteilung weltweit fairer gestalten und in allen Bereichen Verschwendung beenden.
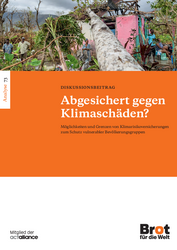


Hinweis: Die Spendenbeispiele sind symbolisch. Durch Ihre zweckungebundene Spende ermöglichen Sie uns dort zu helfen, wo es am dringendsten ist.
56 € (Spendenbeispiel) Mit 56 € kann zum Beispiel ein Hygiene-Paket für eine geflüchtete Familie finanziert werden.
100 € (Spendenbeispiel) Mit 100 € kann zum Beispiel Gemüse-Saatgut für die Bewirtschaftung von ca. 10 Feldern bereitgestellt werden.
148 € (Spendenbeispiel) Mit 148 € kann zum Beispiel ein Regenwassertank mit 2.000 Liter Fassungsvermögen gekauft werden.
Hinweis: Die Spendenbeispiele sind symbolisch. Durch Ihre zweckungebundene Spende ermöglichen Sie uns dort zu helfen, wo es am dringendsten ist.
56 € (Spendenbeispiel) Mit 56 € kann zum Beispiel ein Hygiene-Paket für eine geflüchtete Familie finanziert werden.
100 € (Spendenbeispiel) Mit 100 € kann zum Beispiel Gemüse-Saatgut für die Bewirtschaftung von ca. 10 Feldern bereitgestellt werden.
148 € (Spendenbeispiel) Mit 148 € kann zum Beispiel ein Regenwassertank mit 2.000 Liter Fassungsvermögen gekauft werden.