
Nachhaltige Fischerei statt Überfischung
Fisch ist in vielen Weltregionen ein Grundnahrungsmittel, doch er wird knapp. Durch nicht nachhaltige Fischerei und industrielle Fangmethoden sind die Meere überfischt und die Versorgung der Menschen ist gefährdet. Doch Verbraucher können gegensteuern.
Meere leiden unter nicht nachhaltigem Fischfang
Die Deutschen verzehren jedes Jahr mehr als 14 Kilogramm Fisch, und die steigenden Preise signalisieren den Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass er rar wird. Die Fischbestände in den Weltmeeren schwinden wegen industrieller Fangmethoden, die typisch sind für eine nicht nachhaltige Fischerei.
“
„Wenn weniger als zwei Prozent der Fangschiffe mehr als die Hälfte aller Fische fangen, ist das ungerecht.“
Francisco Marí
Experte für Fischerei bei Brot für die Welt
Weltweite Überfischung und ihre Folgen
Aufgrund der Überfischung vor ihren eigenen Küsten ist die EU inzwischen der größte Fisch-Importeur der Welt. Der von der EU importierte Fisch stammt zum Großteil aus den Fanggebieten armer Länder, obwohl deren Bevölkerung oft unter Mangelernährung leidet. Hinzu kommt, dass bis zu 30 Prozent davon illegal gefangen werden, laut Schätzungen der EU-Kommission. Das heißt ohne Fanglizenz, in Zonen der Kleinfischerei oder mit verbotenen Fangmethoden wie Grundschleppnetzen, die den Meeresboden langfristig zerstören. Ebenso schlimm ist, dass für Barsche, Krabben oder Tintenfisch oft die zehn- bis zwanzigfache Menge anderer Fischarten mitgefangen wird, die bei uns nicht vermarktet werden können. Dieser „Beifang“ wird massenhaft tot über Bord geworfen, was weltweit die Bestände verringert und das Ökosystem Meer aus dem Gleichgewicht bringt.
70 Prozent der Fanggründe überfischt
Die UN-Ernährungsorganisation FAO geht davon aus, dass inzwischen 70 Prozent der weltweiten Fanggründe überfischt sind oder kurz davorstehen. Aufgrund der Überfischung verarmen viele Küstengemeinschaften, weil den Fischern zu wenige und zu kleine Fische in ihre Netze gehen. Die Meeresverschmutzung durch Industrialisierung und Rohstoff-Abbau tut ihr Übriges dazu, da sie den Lebensraum der Fische zerstört.
Nachhaltige Fischerei nützt Meer und Mensch
Die Fischerei-Verträge, die die EU inzwischen mit Entwicklungsländern schließt, gehen in die richtige Richtung und beachten Regeln der nachhaltigen Fischerei: Nur noch bei wissenschaftlich erwiesenem Überschuss darf die EU überhaupt anfragen, ob ihre Fangflotte dort fischen darf, und sie muss die Verträge veröffentlichen. Bei den Entscheidungen sollen Vertreter der Kleinfischer einbezogen werden. Wenn ein EU-Fangschiff gegen die Regeln verstößt, verliert es für mindestens zwei Jahre das Fischerei-Recht in dem Gebiet. Diese Regeln sind ein guter Schutz gegen Überfischung.
Außerdem müssen die Entwicklungsländer in die Lage versetzt werden, ihre Küstengebiete vor Raubfischern zu schützen. Es dürfen nur Fangmethoden eingesetzt werden, die den Beifang von unerwünschten Arten und Jungfischen reduzieren. Fangschiffe aus China, Südkorea und Russland müssen sich ebenfalls an die internationalen Regeln halten. Dafür ist es wichtig, dass die neue Initiative für Transparenz in der Fischerei (FiTI) Erfolg hat, damit Staaten ihre Fischereipolitik offenlegen müssen.
Was Brot für die Welt gegen Überfischung tut
Wir setzen uns dafür ein, dass die Kleinfischer eine Stimme haben, wenn auf internationaler Ebene über ihre Fischgründe verhandelt wird. So haben wir als Mitglied der Koalition für faire Fischerei-Abkommen die Gründung des Verbands der westafrikanischen Kleinfischer unterstützt. Gemeinsam konnten wir bei der Neudefinition der EU-Fischereipolitik 2014 wesentliche Verbesserungen gegen die Interessen der europäischen Fisch-Industrie durchsetzen und so die nachhaltige Fischerei stärken. Vor Mauretanien zum Beispiel dürfen nur noch handwerkliche Fischer Tintenfisch fangen und exportieren. Die Einhaltung dieses Abkommens überwachen wir als Mitglied des entsprechenden EU-Ausschusses. Zusätzlich unterstützen wir weltweit Partnerorganisationen dabei, die von der FAO anerkannten Leitlinien für die Rechte der Kleinfischer in nationales Recht umzusetzen.
Was Sie tun können
Essen Sie weniger Fisch und wählen Sie den gut aus, etwa anhand der Einkaufsratgeber von Greenpeace und WWF. Beide listen die nicht überfischten Arten auf, die Sie guten Gewissens essen können. Achten Sie beim Einkauf zusätzlich auf Ware aus nachhaltigem Fischfang. Manche Produkt-Siegel wie das Marine Stewardship Council (MSC) stehen aber als zu industrie-freundlich in der Kritik, weil sie die erwiesenermaßen nachhaltige Kleinfischerei nicht schützen. Ebenso wenig garantiert das MSC-Siegel faire Arbeitsbedingungen an Bord oder in der Fischfabrik. Bevorzugen Sie daher die Siegel von Bioland und Naturland, die hohe Umwelt- und Sozial-Standards bieten für Fisch aus Zuchtbetrieben. Shrimps und Lachs aus industrieller Fischzucht hingegen sollten Sie komplett meiden, da sie Fischmehl aus Wildfang bekommen und große Mengen Antibiotika.
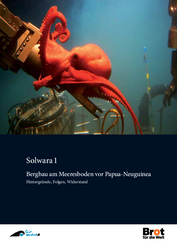
Beiträge zum Thema
Jetzt spenden Unterstützen Sie uns


Hinweis: Die Spendenbeispiele sind symbolisch. Durch Ihre zweckungebundene Spende ermöglichen Sie uns dort zu helfen, wo es am dringendsten ist.
56 € (Spendenbeispiel) Mit 56 € kann zum Beispiel ein Hygiene-Paket für eine geflüchtete Familie finanziert werden.
100 € (Spendenbeispiel) Mit 100 € kann zum Beispiel Gemüse-Saatgut für die Bewirtschaftung von ca. 10 Feldern bereitgestellt werden.
148 € (Spendenbeispiel) Mit 148 € kann zum Beispiel ein Regenwassertank mit 2.000 Liter Fassungsvermögen gekauft werden.
Hinweis: Die Spendenbeispiele sind symbolisch. Durch Ihre zweckungebundene Spende ermöglichen Sie uns dort zu helfen, wo es am dringendsten ist.
56 € (Spendenbeispiel) Mit 56 € kann zum Beispiel ein Hygiene-Paket für eine geflüchtete Familie finanziert werden.
100 € (Spendenbeispiel) Mit 100 € kann zum Beispiel Gemüse-Saatgut für die Bewirtschaftung von ca. 10 Feldern bereitgestellt werden.
148 € (Spendenbeispiel) Mit 148 € kann zum Beispiel ein Regenwassertank mit 2.000 Liter Fassungsvermögen gekauft werden.














