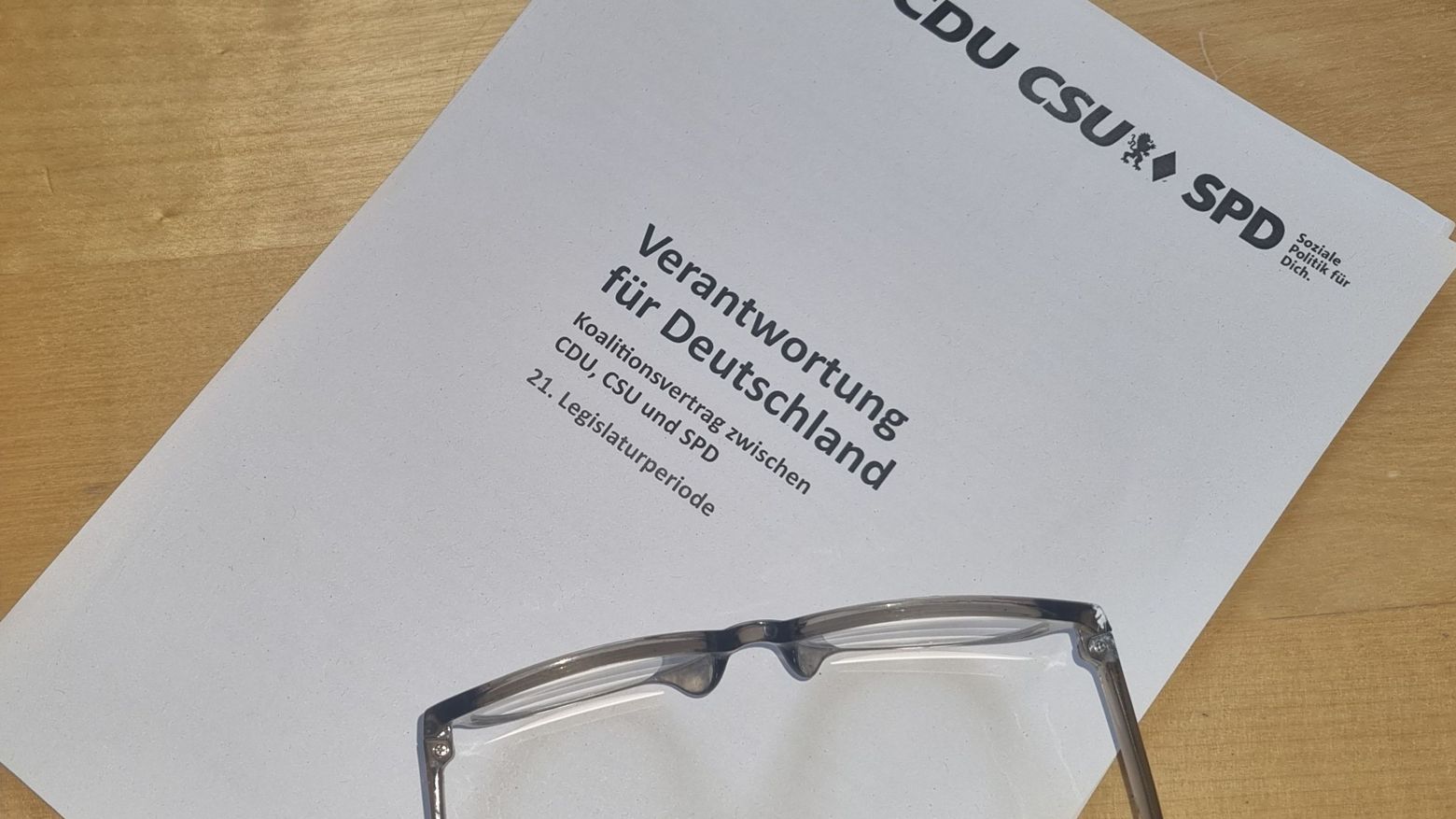Bewegte Tage Anfang Mai liegen hinter uns: eine verstolperte Kanzlerwahl, eine schnell geglückte Papstwahl und ein Gedenktag, der an die Monstrosität des Zweiten Weltkriegs erinnert. Den 8. Mai, den 80. Jahrestag der deutschen Kapitulation, der das Ende des Zweiten Weltkriegs markiert, habe ich – wie viele andere Menschen – auf dem Pariser Platz vorm Brandenburger Tor verbracht. Die dortige Open-Air-Ausstellung „… endlich Frieden?!“ ist sehenswert, ganz sicher. Doch auf den großen Tafeln der Ausstellung bleibt das unsägliche Leid des Kriegs nur angedeutet. Dieses Leid, das der Zweite Weltkrieg mit sich brachte, wirkt bis heute nach – in den Familien, in der Gesellschaft und in der Welt. Mit mulmigen Gefühlen habe ich die Bilder betrachtet, die Tod und Vernichtung zeigen, und mich gefragt, wo wir heute stehen.
Bereitschaft zur Unterstützung nimmt ab
Vielerorts herrschen Krieg und Konflikte: Ukraine, Gaza, DR Kongo, Myanmar – um nur einige zu nennen. Weltweit sind 305 Millionen Menschen laut International Rescue Committee zum Überleben auf humanitäre Hilfe angewiesen – mehr als je zuvor. Und gleichzeitig nimmt die internationale Bereitschaft zur Unterstützung ab: Die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe werden weltweit drastisch gekürzt. Fatal fallen die Kürzungen bei USAID aus, sie reißen ein riesiges Loch: Fortan fehlen 54 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung des Globalen Südens vorrangig im Gesundheitsbereich und bei der humanitären Hilfe. Bis Juli dieses Jahres soll, so US-Außenminister Rubio, die Entwicklungsbehörde vollständig zerschlagen werden. Auch andere Länder wie Frankreich, Großbritannien und Japan kürzen die Mittel für die internationale Zusammenarbeit.
Was geht hier vor?
Hatten nicht die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und die anschließende Not gezeigt, wie wichtig es ist, anderen Ländern beizustehen? Entstand hier nicht die Idee der „internationalen Zusammenarbeit“, wie sie in der Charta der Vereinten Nationen von 1945 verankert ist? Diese Idee scheint plötzlich weit weg.
Lange hat Deutschland selbst von internationaler Solidarität profitiert. Durch den Marshallplan haben die Deutschen existenziell wichtige Unterstützung zum Wiederaufbau erhalten. Diese historische Erfahrung prägte die Bereitschaft, sich in der Entwicklungszusammenarbeit und in der humanitären Hilfe zu engagieren. So entstand der „entwicklungspolitische Konsens“, der tief in der deutschen Gesellschaft verwurzelt schien.
Blick in den Koalitionsvertrag: Ganz im Zeichen der Zeit
Vor dieser Folie ernüchtert der Blick in den Koalitionsvertrag: Man liest viel darüber, dass Deutschland sich wappnen müsse und eigenen Interessen folgen wolle. Ganz im Zeichen der Zeit. Dazu gehört leider auch, dass Deutschland die Mittel für internationale Zusammenarbeit weiter senken will. Das Versprechen, mindestens 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe aufzuwenden, wird kurzerhand aufgekündigt.
Immerhin bleibt anzuerkennen, dass es weiterhin ein eigenständiges Entwicklungsministerium gibt. Dank an alle, die sich hierfür eingesetzt haben. Ob die Stimmen der Ärmsten der Armen am Kabinettstisch tatsächlich Gehör finden werden, wird sich zeigen. Skeptisch stimmt: Die neue Entwicklungszusammenarbeit soll den Privatsektor einbinden und dabei deutsche Interessen stärker berücksichtigen. Die knappen Mittel der Entwicklungszusammenarbeit dienen vermutlich nun stärker der Risikoabsicherung von Unternehmen. Werden davon die am wenigsten entwickelten Länder profitieren? Eher nicht.
Doch gerade diese Länder dürfen nicht vergessen werden: Mindestens 0,2 Prozent des Bruttonationaleinkommens der wohlhabenden Länder sollte ihnen zugutekommen. Dieses Ziel wurde erstmals 1990 formuliert und 2015, auf der dritten UN-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung in Addis Abeba, erneut bekräftigt. Deutschland hat zudem 2015 an seine Zustimmung zur globalen Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung die Zusicherung gebunden: Wir lassen niemanden zurück. Von diesem ausdrücklichen Versprechen liest man nichts im Koalitionsvertrag.
Auch diese Versprechen fehlen
Leider werden auch andere Versprechen mit keinem Wort erwähnt. Für die zukünftige Finanzierung von Klimaschutz und Klimaanpassung im Globalen Süden fehlen konkrete Zusagen, wie sie die Regierung von Angela Merkel noch gegeben hatte; die Klimamittel sollten auf sechs Milliarden Euro bis zum Jahr 2025 gesteigert werden. Es scheint, als wollte sich Deutschland aus der Verantwortung stehlen, indem es auf andere Geber wie Schwellenländer verweist. Ein Hinweis auf einen fairen Beitrag zum globalen Klimafinanzierungsziel von bis zu 300 Milliarden US-Dollar bis 2035, vereinbart beim Klimagipfel in Baku, fehlt ebenfalls.
Die internationale Klimafinanzierung wurde bisher fast ausschließlich über die Entwicklungsfinanzierung bereitgestellt. Diese Mittel sollen nun gekürzt werden mit gravierenden Folgen nicht nur für die Bekämpfung von Armut und Hunger. Es ist zu befürchten, dass auch die Klimafinanzierung reduziert wird, und somit weniger Mittel für Hitzeschutz und Deiche sowie für den Ausbau von Erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen. Dies wäre ein folgenschwerer Rückschritt für die internationale Klimadiplomatie und die Unterstützung der ärmsten Bevölkerungsgruppen im Globalen Süden.
Große Sorgen bereitet zudem die Ankündigung, Entwicklungszusammenarbeit, Handels- und Wirtschaftspolitik, die bilateralen Beziehungen insgesamt, einer restriktiven Migrationspolitik unterzuordnen. Auch dies gehört zu den Konturen der neuen Entwicklungszusammenarbeit, die vermeintlich die deutschen Interessen fest im Blick hat – aber dabei viel zu kurz denkt.
Da liest man mit Erleichterung, dass sich der Koalitionsvertrag zum Recht auf Asyl in Deutschland bekennt und zur finanziellen Unterstützung wichtiger Aufnahmeländer. Grundlage dafür, dass Deutschland eine Säule des globalen Flüchtlingsschutzes bleibt.
Es geht um die Ärmsten der Armen
Anlässlich des Katholikentages 2024 sagte Friedrich Merz bei einem Empfang der Konrad-Adenauer-Stiftung: „Und Friedenspolitik bedeutet für uns außerdem, beizutragen zur Linderung der Not gerade in den ärmsten Ländern der Welt. Auch dazu verpflichtet das ‚C‘, unsere christliche Überzeugung von der gleichen Würde aller Menschen. Wir finden uns nicht damit ab, dass weltweit jeder zehnte Mensch unter Hunger und bitterer Armut leidet.“
Hoffentlich erinnert sich der neue Bundeskanzler an seine Worte. Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe können in der Tat einen wichtigen Beitrag zur Friedenspolitik leisten. Angesichts der Vielzahl an Kriegen, Konflikten und Krisen, deren katastrophalen Folgen gerade die Ärmsten der Armen im Globalen Süden besonders hart treffen, braucht es aber stärkere Ambitionen als jene, die der Vertrag der Regierungsparteien erkennen lässt.