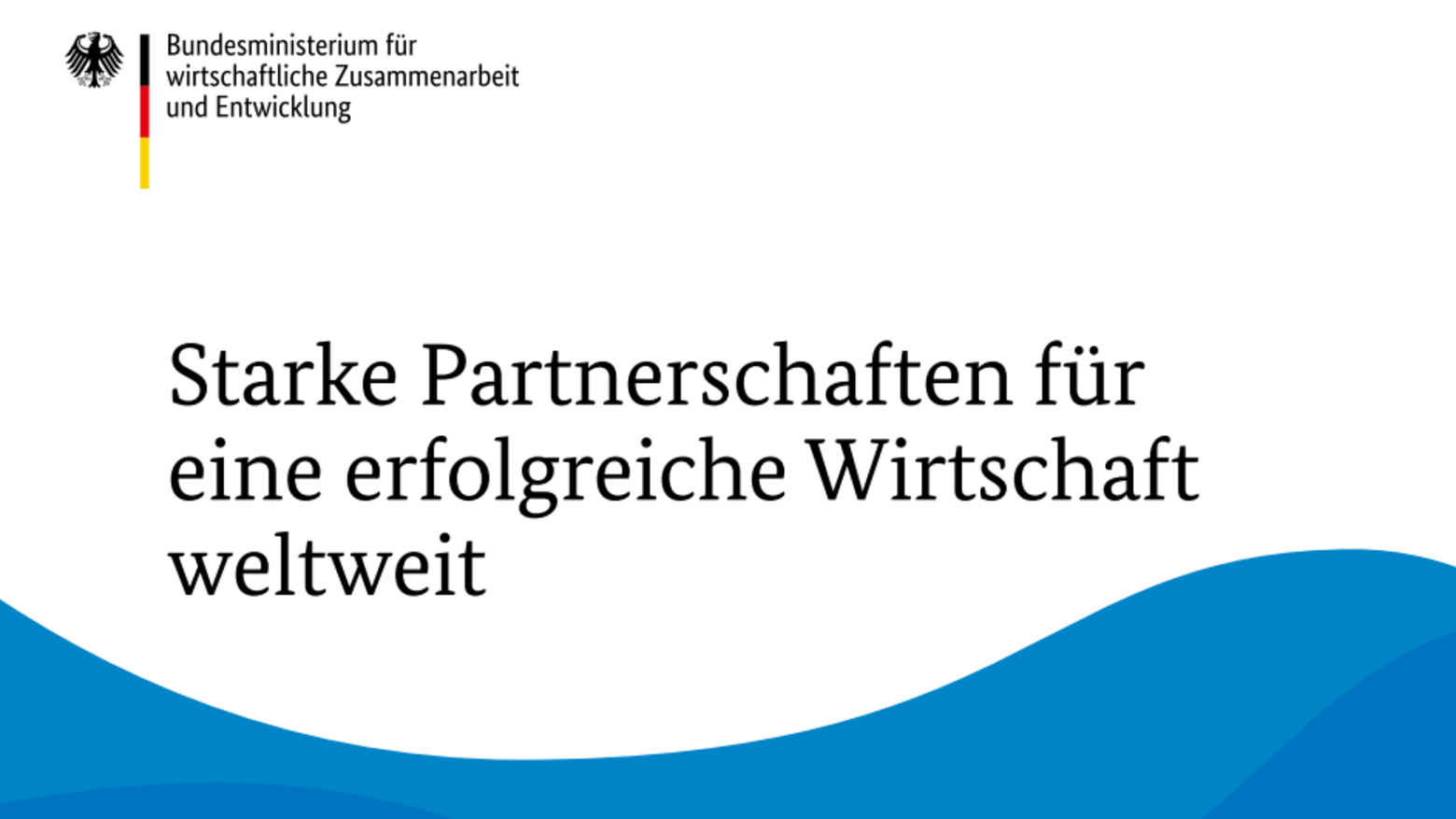Unter dem Titel „Starke Partnerschaften für eine erfolgreiche Wirtschaft weltweit“ will das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) künftig die Interessen von Wirtschaftsverbänden und Unternehmen stärker in Regierungsverhandlungen berücksichtigen und Wirtschaftsakteur*innen an entwicklungspolitischen Vorhaben beteiligen. Unter anderem sollen sogenannte kritische und strategische Rohstoffe dort, wo deutsche und europäische Unternehmen „besondere Versorgungs- und Investitionsinteressen“ haben „stärker in den Blick“ genommen werden. Bereits der Koalitionsvertrag erklärte die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Sicherung des Zugangs zu Rohstoffen „im Lichte unserer Interessen“ zum Schwerpunkt.
Der Aktionsplan spricht von „Partnerschaften im gegenseitigen Interesse, von denen alle Seiten profitieren“ – doch die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) droht, wirtschaftlichen Interessen deutscher Unternehmen untergeordnet zu werden.
Vernachlässigung entwicklungspolitischer Kernziele
Mit 10,3 Milliarden Euro verfügt das BMZ für 2025 über rund eine Milliarde Euro weniger als im Vorjahr. Bereits seit 2024 verfehlt Deutschland seine internationalen Verpflichtungen bei öffentlichen Entwicklungsleistungen (ODA) wieder; für die kommenden Jahre sind weitere Kürzungen geplant. Besonders betroffen sind unter anderem die Bereiche Globale Gesundheit, Krisenbewältigung und internationaler Klima- und Umweltschutz. Die neue Schwerpunktsetzung wird die Kürzungen in Kernbereichen der EZ noch verschärfen.
Bereits heute fließen öffentliche Gelder in Milliardenhöhe in die Außenwirtschaftsförderung. Künftig sollen Instrumente der EZ und der Außenwirtschaftsförderung (noch) enger verzahnt werden. Entwicklungspolitisch problematisch ist das auch, weil profitorientierte Unternehmen ihre Investitionen an Gewinn ausrichten und nicht danach, wo entwicklungspolitisch der größte Bedarf besteht. Die Bundesregierung muss ihre internationale Verpflichtung, das vereinbarte Ziel von 0,7% des Bruttonationaleinkommens für öffentliche Entwicklungsleistungen aufzuwenden, einhalten; Programme, die primär auf die Förderung deutscher Wirtschaftsinteressen ausgerichtet sind, dürfen nicht über diese Mittel finanziert werden.
Versprechen von Wertschöpfung fragwürdig
Wie der propagierte Win-Win-Ansatz ausgestaltet wird, der laut Aktionsplan zum Tragen kommen soll, wenn das BMZ und das BMWE (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) künftig eine Flankierung privatwirtschaftlicher Investitionen in Rohstofflieferketten in Ländern in Afrika, Lateinamerika und Asien prüfen wollen, um unter anderem lokale Wertschöpfung zu fördern, wird nicht näher erläutert. Ohne eine Strategie, die konsequent am sozial und ökologisch ausgerichteten Aufbau lokaler Wertschöpfung ausgerichtet ist, droht allerdings eher Druck auf Partnerländer, den exportorientierten Rohstoffabbau auszuweiten. Geplante Handelsabkommen, wie das Mercosur-Abkommen, setzen zusätzliche Anreize gegen die Weiterverarbeitung vor Ort.
Risiken für Umwelt und Menschenrechte
Aufgrund ihrer menschenrechtlichen und ökologischen Risiken zählen der Abbau und die Verarbeitung von metallischen Rohstoffen zu den Hochrisikosektoren. Schwerwiegende Umweltverstöße – bis hin zur Zerstörung ganzer Ökosysteme – und die Verletzung von Arbeits- und Menschenrechten sowie der Rechte indigener Völker in den Lieferketten auch deutscher und europäischer Unternehmen sind Symptome eines globalen extraktivistischen Wirtschaftsmodells, welches Kosten systematisch auf Umwelt und Menschen vor allem in Ländern des Globalen Südens auslagert. Gleichzeitig wächst der Bedarf von Industrieländern wie Deutschland an metallischen Rohstoffen wie Kobalt, Nickel und Lithium stetig.
Der Aktionsplan hebt zwar die hohen Nachhaltigkeitsstandards der deutschen Industrie hervor, erläutert aber nicht, wie deren Einhaltung gewährleistet werden soll. Zudem hat die deutsche Bundesregierung das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz abgeschwächt und setzt sich auf EU-Ebene für eine massive Verwässerung der Europäischen Lieferkettenrichtlinie ein, anstatt auf eine schnelle und wirksame Umsetzung hinzuarbeiten. Dies geschieht auch auf Druck einflussreicher Unternehmen und von Wirtschaftsverbänden – die laut Aktionsplan künftig systematischer einbezogen werden sollen.
Die Zivilgesellschaft bleibt außen vor
Im Aktionsplan findet sie keine Erwähnung. Jedoch ist die Arbeit zivilgesellschaftlicher Akteur*innen unerlässlich für die Förderung von gesellschaftlicher und politischer Teilhabe, den Schutz der Menschenrechte, Widerstand gegen autoritäres Regierungshandeln und eine sozial gerechte ökologische Transformation weltweit. Beim Rohstoffabbau sind es diese Akteur*innen, die Missstände wie Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung aufdecken und die Einbindung von Rechte-Inhabenden fordern und befördern, nicht selten unter großen Risiken für Leib und Leben. Umso gravierender, dass durch die BMZ-Kürzungen insbesondere auch Fördermittel für zivilgesellschaftliche Organisationen weltweit entfallen.
Zivilgesellschaftliche Organisationen sind, wie Beispiele zahlreicher Partnerorganisationen von Brot für die Welt zeigen, nicht nur von immer enger werdenden zivilgesellschaftlichen Handlungsräumen weltweit betroffen. Sondern aktuell auch ganz gravierend vom globalen Förderrückzug, besonders dem der USA. Deutschland und die EU stehen darum in der Verantwortung: Sie sollten ihre Unterstützung aufstocken, nicht kürzen.
In der Rohstoffpolitik braucht es einen grundlegenden Kurswechsel
Statt einseitig auf die Sicherung knapp werdender Rohstoffe zu setzen, braucht es in der deutschen Rohstoffpolitik einen grundlegenden Kurswechsel – eine Rohstoffwende: Das bedeutet insbesondere, unseren hohen Verbrauch metallischer Rohstoffe, vor allem von Primärrohstoffen, absolut zu reduzieren. Dafür sind vor allem eine konsequente Umsetzung einer ganzheitlichen Kreislaufwirtschaft und sektorspezifische Strategien, wie eine umfassende Mobilitätswende, die über eine Antriebswende hinausgeht und unter anderem den Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs und alternativer Mobilitätsangebote stärker fördert, notwendig. Das verringert einseitige Rohstoffabhängigkeiten und stärkt die Versorgungssicherheit.
Zusammenarbeit an Bedürfnissen der Partnerländer und deren Bevölkerung ausrichten
Die Rechte und Interessen der lokalen Bevölkerung müssen im Zentrum von EZ stehen. Dafür ist es unerlässlich, zivilgesellschaftliche Akteur*innen weltweit eng in (entwicklungs-)politische Entscheidungsprozesse und deren Umsetzung einzubeziehen. Wenn es um wirtschaftliche Zusammenarbeit geht, müssen die Einhaltung höchster Umwelt- und Menschenrechtsstandards und der sozial und ökologisch ausgerichtete Aufbau von Wertschöpfung und Möglichkeiten der wirtschaftlichen Diversifizierung in Partnerländern handlungsleitend sein. Eine Rohstoff- und Energiewende weltweit und ein – auch global – gerechter Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft müssen durch das kohärente Zusammenwirken von Politikfeldern unterstützt werden.
Globale Verantwortung und eigenes Interesse
Wachsende globale Herausforderungen wie die dreifache planetarische Krise – Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Umweltverschmutzung – und weltweit zunehmende gewaltsame Konflikte (auch) durch internationale Zusammenarbeit wirksam zu adressieren und eine sozial-ökologische Transformation weltweit zu ermöglichen ist sowohl eine Frage unserer globalen Verantwortung – darüber hinaus aber auch im eigenen sicherheits- und wirtschaftspolitischen Interesse Deutschlands und der EU.