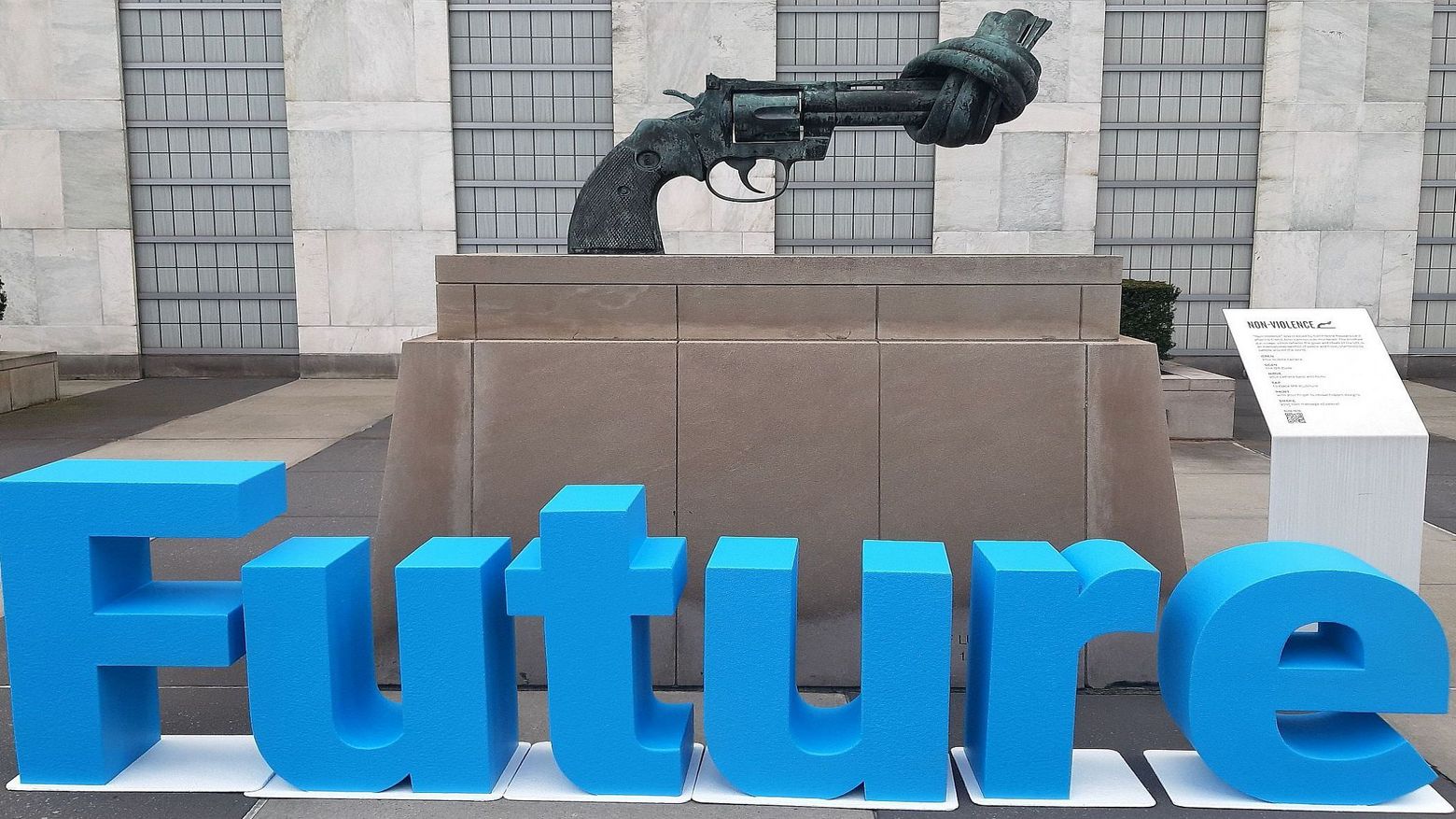„Manche Kritik an den Vereinten Nationen klingt bitter und zynisch, ist von fast jubilierendem Pessimismus – so, als hoffe man heimlich, dass die Schwächen der Organisation Idee und Ziel widerlegten. Doch Rückschläge auf dem Weg zu einem Ideal beweisen nicht notwendig, dass jenes Ideal falsch war, sondern oft nur, dass der Weg besser sein könnte.“ Diese Worte stammen von Willy Brandt, als er am 26. September 1973 als erster Kanzler der Bundesrepublik Deutschland vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen sprach. Seine Worte klingen heute, 80 Jahre nach Gründung der UNO (United Nations Organization), aktueller denn je.
Die Vereinten Nationen stehen vor einer ihrer schwersten Bewährungsproben. In einer Zeit globaler Krisen – von der Missachtung internationaler Normen über anhaltende Gewaltkonflikte bis hin zur Klimakrise und zunehmender Ungleichheit auf der Welt – droht die UNO ihre Relevanz zu verlieren, mit dramatischen Folgen für den internationalen Zusammenhalt. Dabei geht es längst nicht mehr nur um die Einhaltung von Regeln. Es geht um die Glaubwürdigkeit des gesamten Systems. 2025 markiert einen neuen Tiefpunkt: Im Zentrum stehen nicht nur ungelöste Konflikte, sondern auch Finanzierungslücken aufgrund ausbleibender Zahlungen und drastischer Budgetkürzungen.
UN80-Initiative
Was also tun angesichts schwindender Ressourcen und zunehmender Herausforderungen? UNO-Generalsekretär António Guterres hat mit der UN80-Initiative einen Reformprozess angestoßen. Dieser umfasst drei Säulen: sofortige Einsparungen, eine Überprüfung der Mandate und die Entwicklung langfristiger institutioneller Reformen. Erste Maßnahmen wurden bereits eingeleitet – darunter eine geplante Budgetkürzung für 2026 von 20 Prozent. Gleichzeitig arbeiten verschiedene Arbeitsgruppen an Konzepten für eine strukturelle Neuaufstellung.
Dabei geht es auch um Fusionen und Reformen verschiedener UN-Organisationen, deren Aufgaben sich teilweise überschneiden. Dazu gehören unter anderem Vorschläge zur Zusammenlegung der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) mit dem UN-Umweltprogramm (UNEP), zur Integration des UN-Programms zu HIV/AIDS (UNAIDS) in die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und zur Zusammenlegung mehrerer Gremien zu einer einzigen Menschenrechtsagentur.
Die Debatte beginnt gerade erst
Die UNO steht vor der grundlegenden Frage, wofür sie steht und was sie realistisch leisten kann. Dabei prallen unterschiedliche Visionen aufeinander: Westliche Staaten betonen Ziele wie Frieden, Sicherheit und Menschenrechte, für viele Länder des Globalen Südens liegt der Fokus auf Entwicklung, Gerechtigkeit und fairer Finanzierung. Eine ernsthafte Debatte über diese Positionen fehlt bisher. Klar ist, dass kurzfristige Kostensenkungen keine langfristige Strategie ersetzen – und schon gar nicht politische Blockaden lösen, die der Organisation im Kern zu schaffen machen.
Zentral ist auch die Frage um mehr Mitbestimmung für den Globalen Süden. Zwar wurde beim UN-Zukunftsgipfel 2024 erstmals die Notwendigkeit einer demokratischeren und inklusiveren Struktur anerkannt – inklusive einer Stärkung der Repräsentanz Afrikas und Lateinamerikas. Doch konkrete Fortschritte bleiben bisher aus. Ohne einen ständigen Sitz für Afrika im Sicherheitsrat, so die wiederholte Forderung vieler afrikanischer Staaten, könne die UNO nicht glaubwürdig von globaler Gleichberechtigung sprechen. Die Legitimität und Zukunft der Vereinten Nationen liege in der uneingeschränkten Beteiligung an Entscheidungsprozessen.
Keine Alternative
Die kommenden Monate werden entscheidend sein. Zunächst geht es um die Verabschiedung des UN-Haushalts für 2026 mit seinen drastischen Kürzungen. Zahlreiche UN-Einrichtungen müssen ihre Präsenz vor Ort abbauen. Die sozialen und politischen Folgen könnten sich bald zeigen – in Form von Instabilität, Flucht, Radikalisierung. Was die weiteren Reformschritte angeht, so ist derzeit noch vieles offen. Wird sich der Globale Süden mit seinen Forderungen nach mehr Mitbestimmung durchsetzen? Wie kann sichergestellt werden, dass die Reformen zu keinen Nachteilen für die Entwicklungsländer beim Zugang zu Technologie, Expertise und Finanzen führen? Geopolitisch handelt es sich um einen äußerst schwierigen Zeitpunkt für ein solches Reformvorhaben, so tief wie die Gräben zwischen den Vetomächten gerade sind. Einige erwarten auch, dass es vor der Wahl von Guterres Nachfolge Ende 2026 gar keine weitreichenden Entscheidungen geben wird.
Trotz aller Kritik und Defizite bleibt die UNO unverzichtbar. In Krisen- und Katastrophengebieten leistet sie humanitäre Hilfe, vermittelt in Konflikten, schützt Zivilist*innen, entsendet Friedenstruppen, sichert Lebensmittel- und Impfprogramme und verhindert, dass Krisen noch schlimmer eskalieren. Die UNO ist ein Raum, in dem miteinander gesprochen wird, auch wenn es schwierig wird; in dem große und kleine Staaten ihre Positionen gleichermaßen darlegen können. Dieser Gleichheitsanspruch macht die UNO besonders und wichtig. Man kann vieles an der UNO kritisieren: Ineffizienz, Machtasymmetrien, politische Blockaden. Aber eine Welt ohne die Vereinten Nationen wäre eine ärmere, gefährlichere Welt.
Blick nach vorn
Diese Krise eröffnet auch einen Möglichkeitsraum für eine Debatte über Zweck, Prioritäten und Reformbedarf der UNO. Klar ist: Ohne politische Rückendeckung der Mitgliedstaaten – insbesondere der großen Geberländer – kann es keinen „großen Wurf“ geben. Die Vereinten Nationen waren nie perfekt. 80 Jahre nach ihrer Gründung gilt immer noch: Ihre Schwächen liegen nicht in der Idee – sondern im Unwillen ihrer Mitglieder, sie zu stärken.
Frieden, Völkerrecht, Menschenrechte, Klimagerechtigkeit, nachhaltige Entwicklung, gerechte globale Mitbestimmung und Entscheidungsstrukturen sowie ein Fokus auf die am wenigsten entwickelten Länder und besonders vulnerablen Gruppen müssen im Zentrum stehen. Dafür braucht es die Bereitschaft innerhalb der UNO selbst, aber auch den politischen Willen der Mitgliedstaaten. Es ist an den Regierungen – auch an der Bundesregierung – sich diplomatisch, politisch und finanziell stärker in den Reformprozess einzubringen.
Die Vereinten Nationen können auch in Zukunft ein notwendiger Ort sein – für Vermittlung, für Schutz, für Zusammenarbeit. Was wäre die Alternative? Eine Welt ohne Regeln, ohne gemeinsame Verantwortung?